«Die Schweiz den Schweizern»?
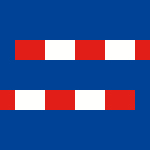
«Zu viel ist zu viel!» titeln die gegenwärtigen Abstimmungsplakate. Sie reihen sich ein in die «Überfremdungs»-Kampagnen, die seit dem frühen 20. Jahrhundert die Debatten um «Fremde» geprägt haben. Es wäre aber verfehlt, die Diskussion einzig auf der Ebene von demographischen Projektionen führen zu wollen. Es geht um mehr. Letztlich geht es um die politische Definition des «wir» und darum, welche Rechte die Menschen haben sollen, die in die Schweiz kommen.
Die Abstimmungen zur Personenfreizügigkeit haben nach der Vorlage zum EWR-Beitritt, die 1992 nach einer kontroversen Kampagne mit einer schmalen Mehrheit von 50,3% der Stimmbürger*innen abgelehnt wurde, den Weg der Bilateralen Verträge mit der Europäischen Union regelmässig bestätigt. Die Bilateralen I (2000) wurden mit einer Mehrheit von 67,2% unterstützt, die Abstimmungen zur Erweiterung der Personenfreizügigkeit jeweils mit 56,0% (2005) und 59,6% (2009). Die Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative MEI 2014 stoppte diesen Trend, wenn auch mit knappem Resultat (50,3%). Da die Bilateralen Verträge nicht explizit Gegenstand jener Abstimmung gewesen waren, musste der Bundesrat und das Parlament mit einem «Inländervorrang light» nachjustieren, um nicht das Freizügigkeitsabkommen (FZA) und somit die Bilateralen Verträge auszuhebeln. Die neue «Begrenzungsinitiative» der SVP, die nun eine Kündigung der Personenfreizügigkeit explizit anstrebt, radikalisiert die Forderung der MEI und gefährdet somit das ganze Vertragswerk der Bilateralen.
Diese Radikalisierung lässt sich nur in einem historischen Rückblick einordnen. Bei der bevorstehenden Abstimmung geht es nur vordergründig um Demographie und Saläre. In Tat und Wahrheit hat die Zuwanderung seit dem FZA das der Abwehr des Fremden zugrunde liegende Selbstverständnis erodieren lassen. Mobile europäische Arbeitskräfte treffen nicht mehr als Bittsteller*innen auf ein uneingeschränktes gesellschaftliches und staatliches Abwehrdispositiv, sondern sind Träger*innen von Rechtstiteln auf Niederlassung und Integration geworden. Dieser Paradigmenwechsel ist der grundsätzliche Stein des Anstosses, selbst wenn es keine weitere Zuwanderung in die Schweiz gäbe.
Mit dem Fremden politisieren
Die Begrenzungsinitiative, die von ihren Gegner*innen in Bezug auf ihre Auswirkungen auf die Bilateralen Verträge auch als Kündigungsinitiative bezeichnet wird, hängt eng mit der Ende des 19. Jahrhunderts eingesetzten Debatte um die «Überfremdung» des Landes zusammen. «Überfremdung» hat sich seither als ein originär schweizerischer politischer Kampfbegriff im deutschsprachigen Raum etabliert. Doch bei der «Überfremdung» ging es nie allein um demographische Entwicklungen (siehe Braun 1970). Ängste vor kultureller oder wirtschaftlicher «Überfremdung» spielten stets eine ebenso wichtige Rolle und halfen selbst in Phasen sinkender Ausländerzahlen, gegen das «Fremde» zu mobilisieren. Dies war insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg der Fall, als erste «Überfremdungs»-Initiative zur Abstimmung kamen, obwohl die Zahl der Ausländer*innen bereits im Krieg markant abgenommen hatte (Garrido 1987). Diese Debatte um die «Überfremdung» war Folge des Aufbaus eines ausländerpolitischen Abwehrdispositivs im Krieg (Gründung Eidgenössische Fremdenpolizei 1917) und fand ihren Widerhall im Bundesgesetz zu «Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer» (ANAG) von 1931.

Poster “Klauen weg! Die Schweiz den Schweizern“, Paul Kammüller (1919)
Die helvetische Denkschablone gegenüber den Fremden setzte sich nach dem Zweiten Weltkrieg fort. War zunächst den Gewerkschaften die Anwesenheit der Ausländer*innen suspekt, mobilisierte in den 60er-Jahren eine offen fremdenfeindliche Bewegung um James Schwarzenbach gegen die Ausländer*innen in der Schweiz. Genau vor 50 Jahren kam es zur kontroversen Abstimmung über die sogenannte Schwarzenbach-Initiative, die eine Ausweisung von 300’000 ausländischen Arbeitskräften forderte und von lediglich 54% der Stimmbevölkerung abgelehnt wurde. Dieses politische Patt blockierte danach auf Jahre etwaige migrationspolitische Reformen, was letztlich dem Ziel der Promotor*innen des Überfremdungsdiskurses entgegenkam (siehe Serafini 2020).
Trotz abnehmenden Ausländerzahlen nach der Erdölkrise (1973/74) blieb die Mobilisierung gegen die «Überfremdung» hoch. Periodisch wurden Abstimmungen initiiert, unabhängig von der Bevölkerungsentwicklung. Letztlich ging es um die schiere Präsenz und Sichtbarkeit ausländischer Personen und um die Frustration über die Unmöglichkeit, sie abzuschieben, wenn man sie nicht mehr braucht. Diese Angst um einen «Verlust an Kontrolle» wird heute reproduziert und versinnbildlich durch die Gegnerschaft zum Freizügigkeitsabkommen.
Die Bilateralen als Paradigmenwechsel
Wenn die helvetische Malaise gegenüber dem Fremden eine dermassen lange Geschichte hat, wie kam es zur Unterzeichnung der bilateralen Verträge inklusive des Freizügigkeitsabkommens? Zwei Entwicklungen sind dafür ausschlaggebend: Die wirtschaftlich harten 90er-Jahre und eine migrationspolitische Umorientierung der Schweiz im selben Zeitraum.
Wirtschaftlich waren die 1990er-Jahre nach der abgelehnten EWR-Abstimmung eine schwierige Zeit in der Schweiz. Gewohnt an Wohlstand und Vollbeschäftigung, geriet die Ökonomie in eine Wachstumsschwäche, die sich auch in erhöhten Arbeitslosenzahlen und sinkendem Pro-Kopf-Einkommen ausdrückte. Zu den Ursachen dieser Wirtschaftsschwäche gehörte mitunter auch ein zunehmend kompetitives Umfeld, welchem sich insbesondere die vormals geschützten Inlandsektoren der Wirtschaft ausgesetzt fanden. Eine Klärung des Verhältnisses zur EU, dem wichtigsten Wirtschaftspartner, war deshalb notwendig, um Hemmnisse zu minimieren und die Wirtschaft zu modernisieren. Die Bilateralen Verträge, zu welchen auch die Personenfreizügigkeit zählte, boten somit eine neue Perspektive des wirtschaftlichen Aufschwungs.
Seit den 1990er-Jahren arbeiteten ausserdem Spitzenbeamt*innen der Verwaltung an der Formulierung einer neuen Migrationspolitik, die diese von der steten Politisierung befreien sollte. Um die Herausforderungen des wirtschaftlichen Wettbewerbs und der Zuteilung von Arbeitskräften zu lösen, wurde in mehreren Berichten (Bericht 1991, Arbenz 1995, Expertenkommission 1997) eine Politik skizziert, die auf die Personenfreizügigkeit innerhalb der EU/EFTA setzte. Die Autor*innen gingen von einer stärkeren Akzeptanz innereuropäischer Mobilität aus. Die modernisierte Migrationspolitik sollte entsprechend auf die binneneuropäische Allokation von Arbeitskräften setzen und sich von der zentral verwalteten und von branchenspezifischen und regionalpolitischen Bedürfnissen gesteuerten Zulassung über Kontingente lösen. Die Rekrutierung von Arbeitskräften sollte unter gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgen und nach einer Phase der Transition vom Markt gesteuert werden. Die unter den Sozialpartnern abgestimmten sogenannten flankierenden Massnahmen sollten vor unfairer Preis- und Lohnkonkurrenz schützen. Das Freizügigkeitsabkommen und das neuen Ausländergesetz (AuG) von 2002, in welchem übrigens der Terminus «Überfremdung» gestrichen wurde, sind Ergebnisse jenes Aufbruchs, während dem erstmals auch die Integration der Migrant*innen in den Fokus rückte.
Schlussfolgerung
Der Kompromiss, der zu den bilateralen Verträgen geführt hat, war stets brüchig, obwohl er mehrfach von der Stimmbevölkerung legitimiert wurde. Marktradikale nehmen an den flankierenden Massnahmen Anstoss. Für xenophobe Befürworter*innen der Massnahmen gegen die «Überfremdung» sind die Rechtstitel der EU/EFTA-Binnenwanderer*innen eine Zumutung. Denn Schweizer*innen haben an Privilegien verloren gegenüber dieser Gruppe von mobilen Arbeitskräften. Diesem von einigen als schmerzhaft empfundenen Verlust, der einer illusionären Denkschablone des eidgenössischen Sonderfalls geschuldet ist, gilt es in den weiteren Debatten zur Personenfreizügigkeit Rechnung zu tragen.
Im erste Teil der vom nccr – on the move und dem Politforum Bern organisierten Veranstaltung vom 27. August 2020 haben unsere Forschenden wissenschaftlich untermauerte, sachliche und pragmatische Argumente in die Debatte rund um die Begrenzungsinitiative eingebracht. Die nachfolgende politische Diskussion zeigte aber, dass die Promotor*innen der Initiative nicht willens sind, auf wissensbasierte Argumente einzusteigen. Sie bevorzugen eine Debatte, die auf Zerrbildern basiert, wie etwa jenes der liederlichen, auf Missbrauch der Sozialwerke erpichten EU/EFTA-Bürger*innen. Auch wenn bei solchen Veranstaltungen nur kleine Brote gebacken werden, bleibt es deshalb notwendiger denn je, dass Wissenschaftler*innen sich dem öffentlichen Streitgespräch stellen und mit ihren Resultaten zur Aufklärung beitragen. Denn es gilt aus Sicht der Akademie auch, die Errungenschaft einer grenzübergreifenden Forschung nicht kampflos aufzugeben.

Diskussion über aktuelle Migrationsbewegungen in und aus der Schweiz, mit Gianni D’Amato, Direktor des nccr – on the move; Jonathan Zufferey, Alumnus Universität Genf; Sarah Progin-Theuerkauf, Professorin Universität Freiburg; Ensar Can, Alumni Universität Basel; Philipp Lutz, PostDoc Universität Genf, moderiert von Simone Prodolliet, EKM. (Bild: Susanne Goldschmid)
Gianni D’Amato ist Professor an der Universität Neuchâtel, Projektleiter und Direktor des nccr – on the move.
Bibliographie:
– Arbenz, Peter (1995). Bericht über eine schweizerische Migrationspolitik. Bern: Eidgenossenschaft.
– Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (1991). Bericht über Konzeption und Prioritäten der schweizerischen Ausländerpolitik der neunziger Jahre. Bern: Eidgenossenschaft.
– Braun, Rudolf (1970). Sozio-kulturelle Probleme der Eingliederung italienischer Arbeitskräfte in der Schweiz. Erlenbach: Rentsch.
– Expertenkommission Migration (1997). Ein neues Konzept der Migrationspolitik. Bern: Eidgenossenschaft.
– Garrido, Angela (1987). Le débat de la politique fédérale à l’égard des étrangers. Lausanne: Université de Lausanne.
– Skenderovic, Damir und Gianni D’Amato (2008). Mit dem Fremden politisieren. Zürich: Chronos.
– Sarah Serafini (2020). 50 Jahre Schwarzenbach-Initiative: In einem anderen Land wäre das nicht möglich gewesen, watson (07.06.2020).


